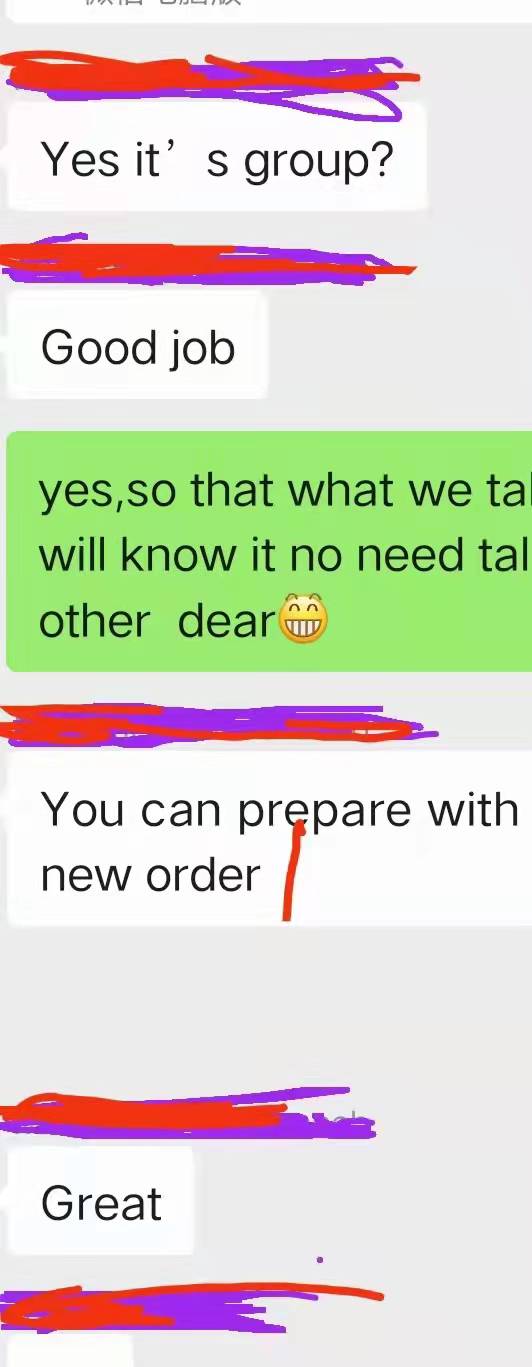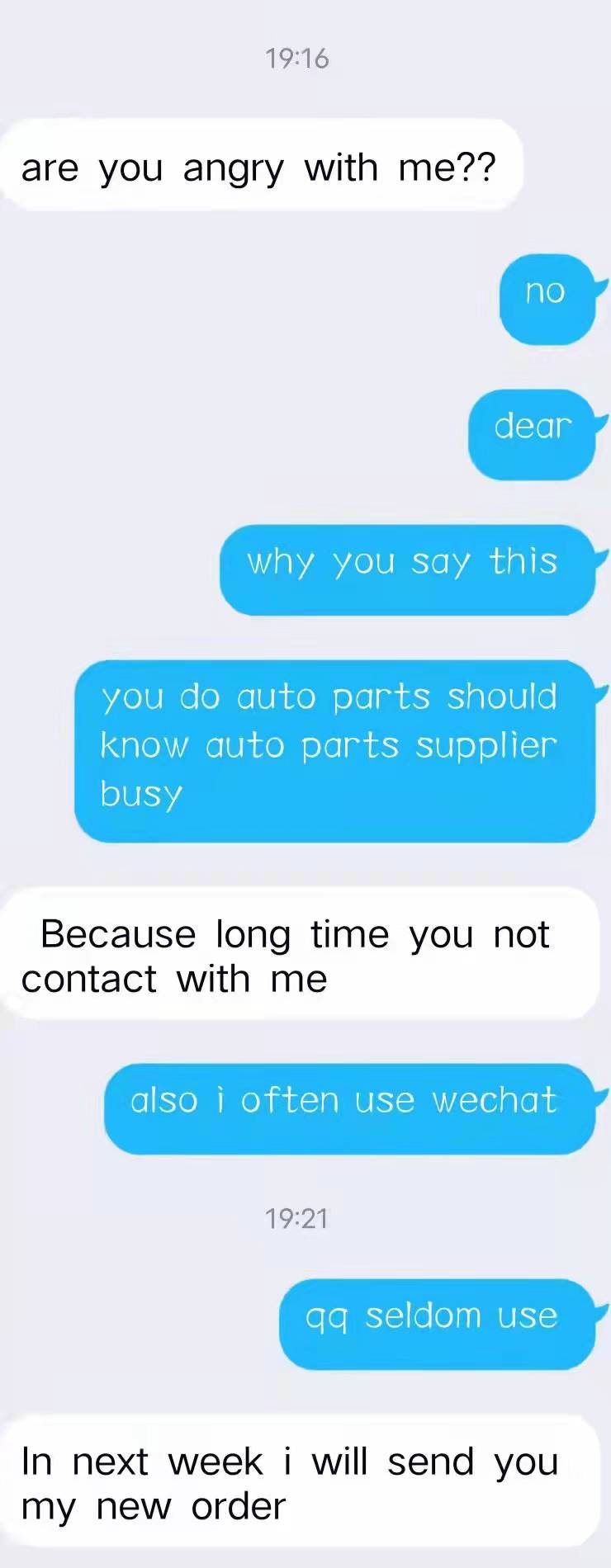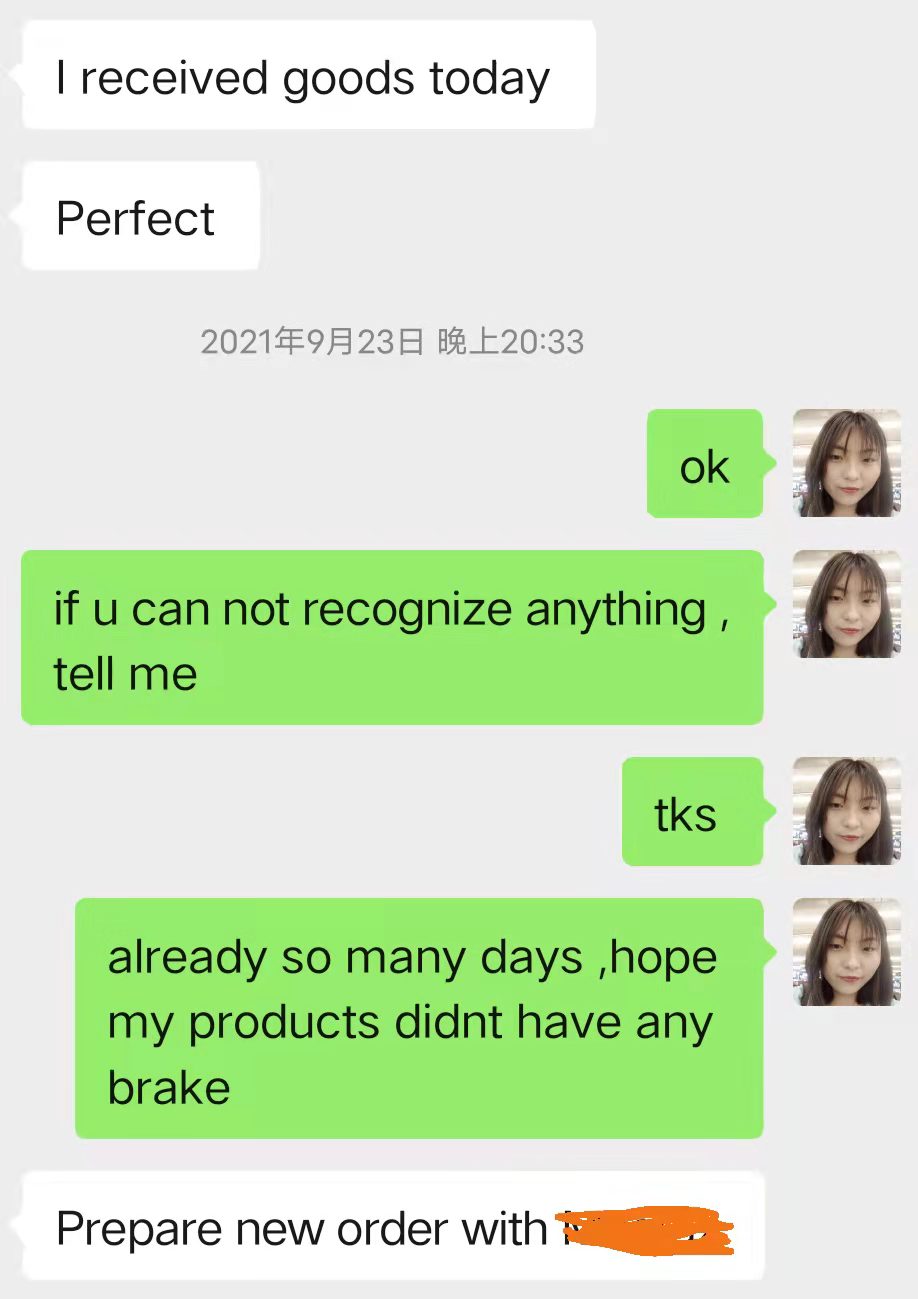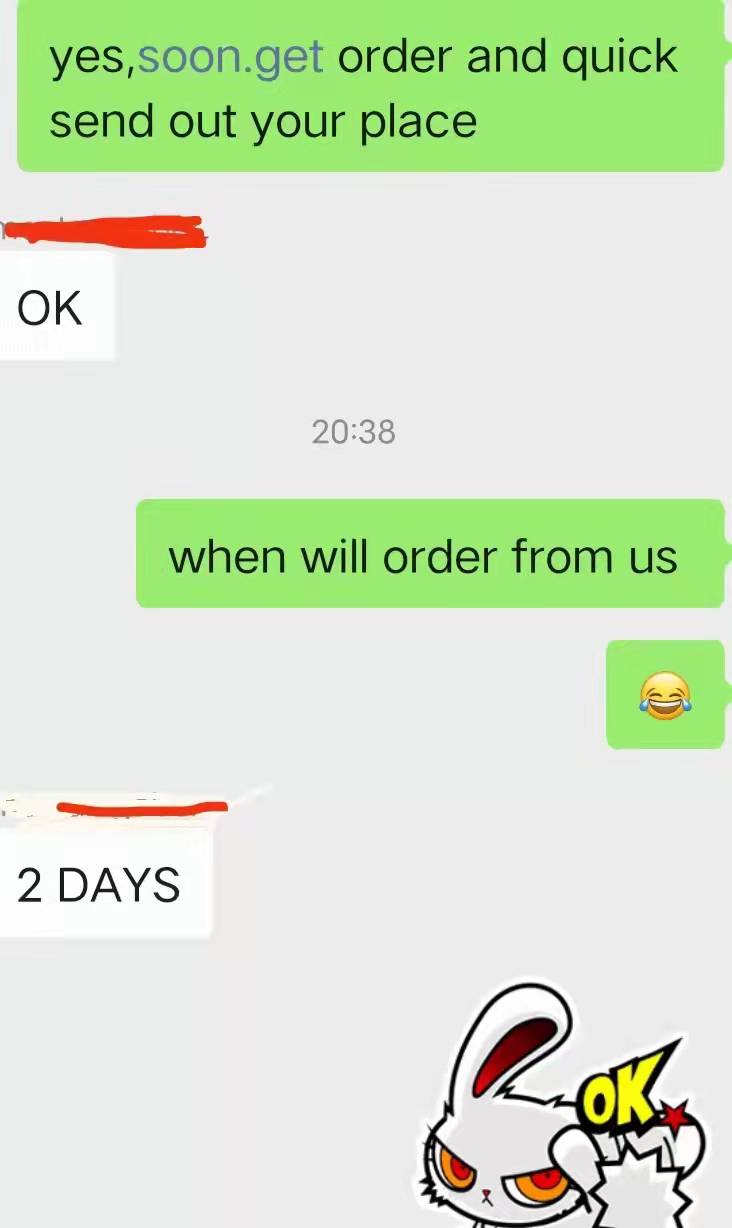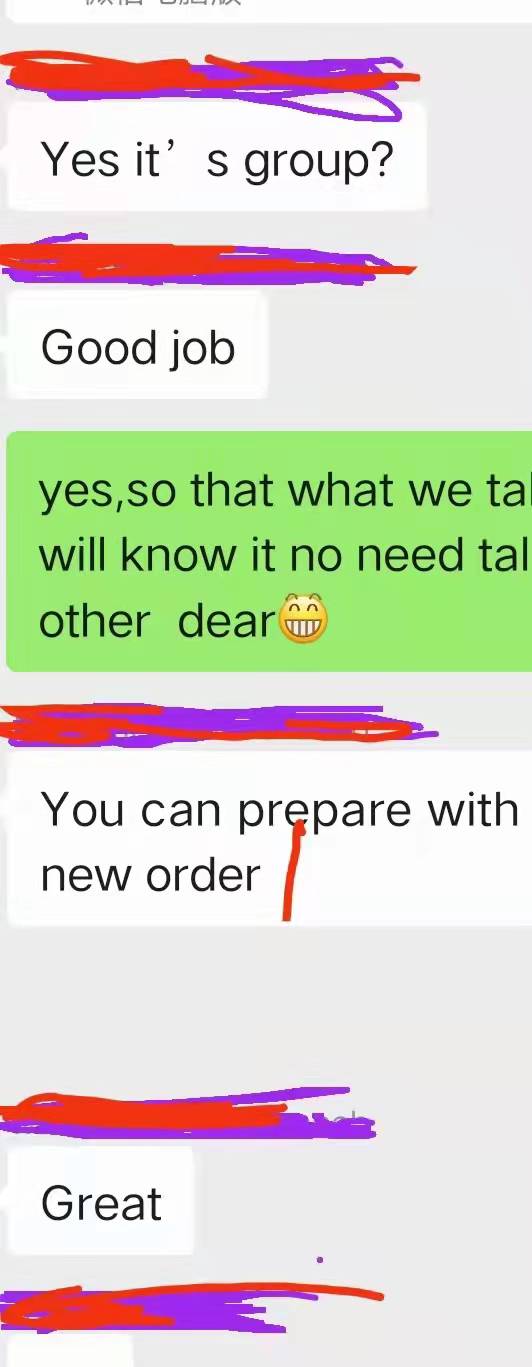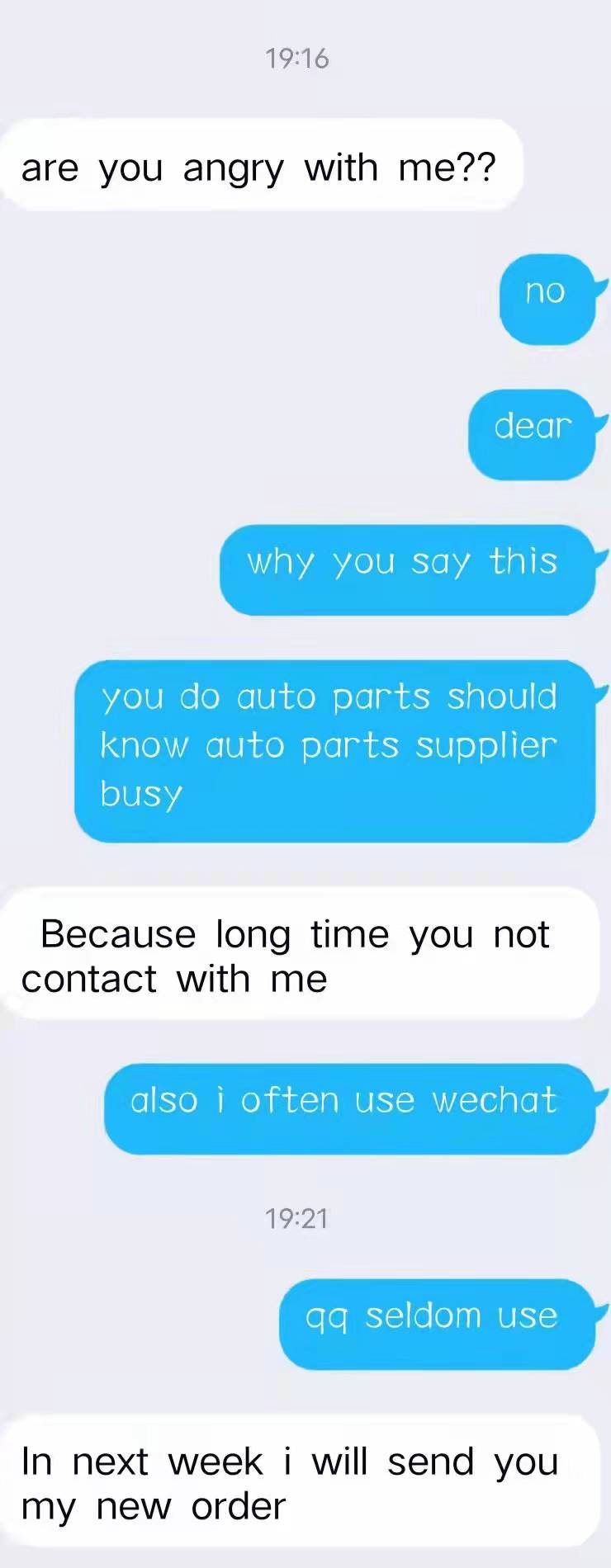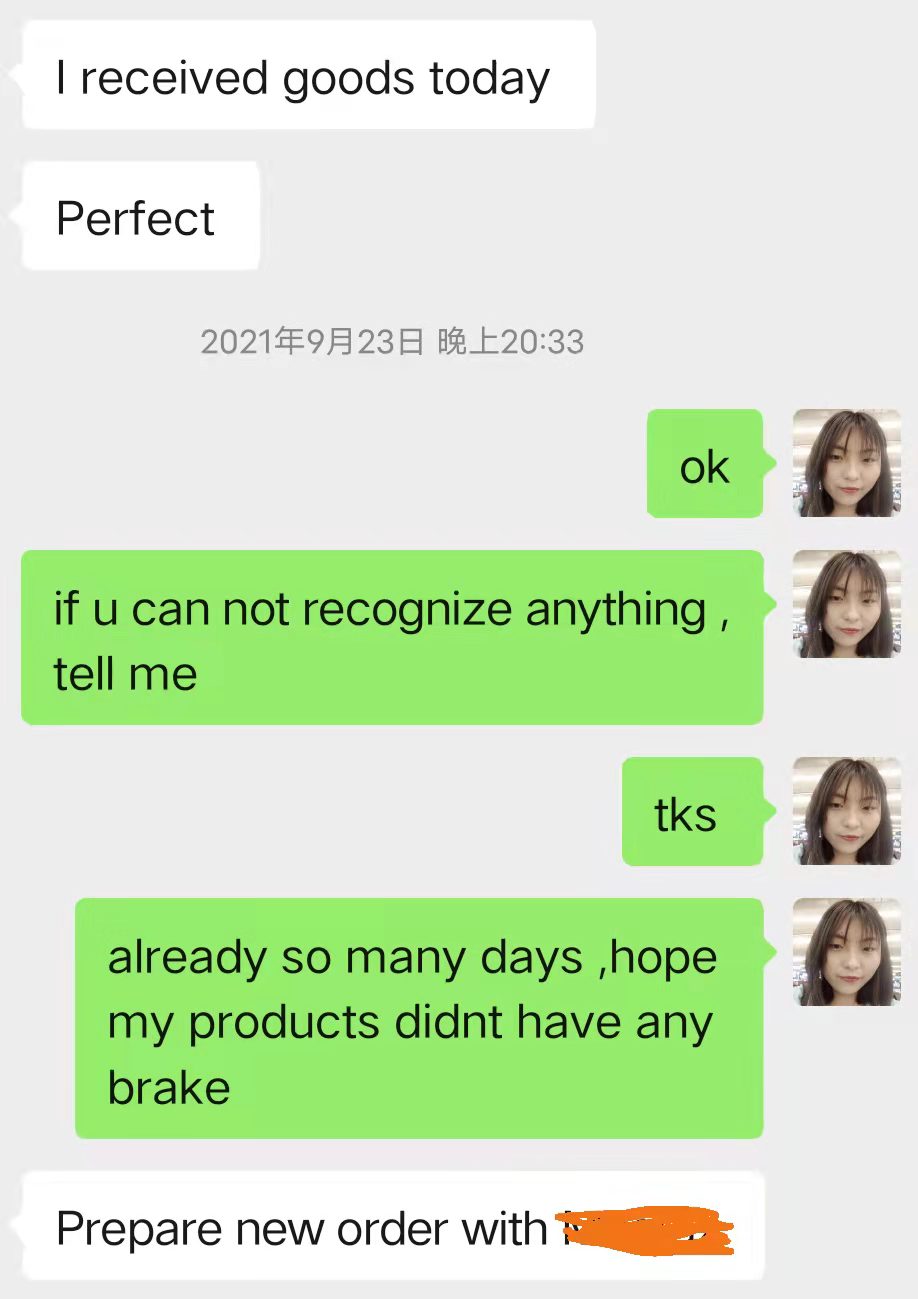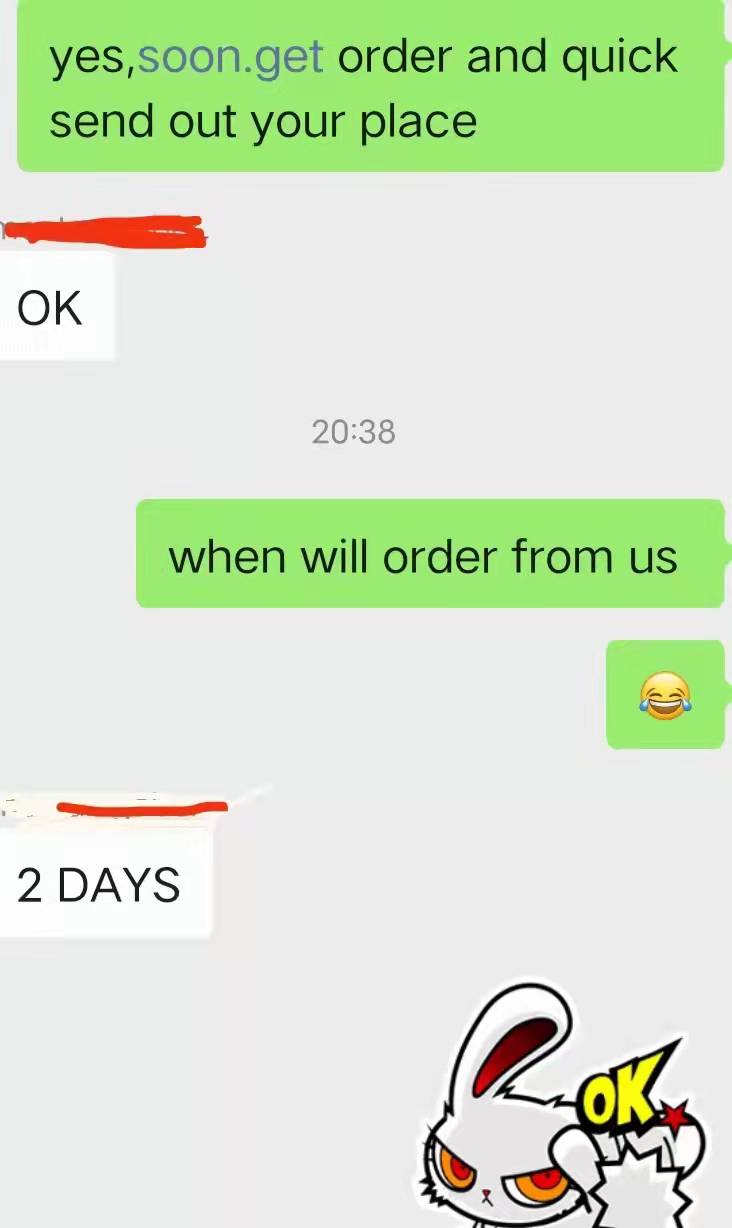Während der Fahrt muss ein Fahrzeug die Fahrtrichtung häufig nach Wunsch des Fahrers ändern. Dies geschieht durch die sogenannte Fahrzeuglenkung. Bei Radfahrzeugen bewirkt der Fahrer die Lenkung dadurch, dass er die Räder (Lenkräder) an der Lenkachse (meist der Vorderachse) mithilfe spezieller Mechanismen um einen bestimmten Winkel zur Fahrzeuglängsachse auslenkt. Bei Geradeausfahrt wird das Lenkrad häufig durch die seitlichen Störkräfte der Fahrbahn beeinflusst und lenkt automatisch aus, um die Fahrtrichtung zu ändern. Der Fahrer kann das Lenkrad über diesen Mechanismus auch in die entgegengesetzte Richtung auslenken, um die ursprüngliche Fahrtrichtung wiederherzustellen. Diese speziellen Einrichtungen zur Änderung oder Wiederherstellung der Fahrtrichtung werden als Fahrzeuglenkung bezeichnet. Die Funktion der Fahrzeuglenkung besteht darin, sicherzustellen, dass das Fahrzeug nach Wunsch des Fahrers gelenkt und gefahren werden kann. [1]
Konstruktionsprinzip Schnitt Sendung
Lenksysteme für Kraftfahrzeuge werden in zwei Kategorien unterteilt: mechanische Lenksysteme und Servolenksysteme.
Mechanisches Lenksystem
Das mechanische Lenksystem nutzt die Körperkraft des Fahrers als Lenkenergie, wobei alle Kraftübertragungsteile mechanisch sind. Das mechanische Lenksystem besteht aus drei Teilen: Lenksteuermechanismus, Lenkgetriebe und Lenkübertragungsmechanismus.
Abbildung 1 zeigt schematisch den Aufbau und die Anordnung des mechanischen Lenksystems. Fährt das Fahrzeug eine Kurve, übt der Fahrer ein Lenkdrehmoment auf das Lenkrad 1 aus. Dieses Drehmoment wird über die Lenkwelle 2, das Lenkgelenk 3 und die Lenkübertragungswelle 4 in das Lenkgetriebe 5 eingeleitet. Das vom Lenkgetriebe verstärkte Drehmoment und die Bewegung nach der Verzögerung werden auf den Lenkkipphebel 6 und dann über die Lenkstange 7 auf den am linken Achsschenkel 9 befestigten Achsschenkelhebel 8 übertragen, sodass der linke Achsschenkel und das von ihm getragene linke Achsschenkel ausgelenkt werden. Um den rechten Achsschenkel 13 und das von ihm getragene rechte Lenkrad um den entsprechenden Winkel auszulenken, ist außerdem ein Lenktrapez vorgesehen. Das Lenktrapez besteht aus den am linken und rechten Achsschenkel befestigten Trapezarmen 10 und 12 und einer Spurstange 11, deren Enden über Kugelgelenke mit den Trapezarmen verbunden sind.
Abbildung 1 Schematische Darstellung des Aufbaus und der Auslegung des mechanischen Lenksystems
Abbildung 1 Schematische Darstellung des Aufbaus und der Auslegung des mechanischen Lenksystems
Die Komponenten und Teile vom Lenkrad bis zur Lenkgetriebewelle gehören zum Lenksteuermechanismus. Die Komponenten und Teile (ohne Achsschenkel) vom Lenkkipphebel bis zum Lenktrapez gehören zum Lenkgetriebemechanismus.
Servolenkung
Die Servolenkung nutzt sowohl die Körperkraft des Fahrers als auch die Motorleistung als Lenkenergie. Normalerweise wird nur ein kleiner Teil der Lenkenergie vom Fahrer aufgebracht, der Großteil wird vom Motor über die Servolenkung bereitgestellt. Bei einem Ausfall der Servolenkung sollte der Fahrer jedoch grundsätzlich in der Lage sein, das Fahrzeug selbstständig zu lenken. Daher wird die Servolenkung durch die Ergänzung mehrerer Servolenkungen auf Basis der mechanischen Lenkung realisiert.
Bei einem Schwerlastfahrzeug mit einer maximalen Gesamtmasse von mehr als 50 t reicht bei einem Ausfall der Servolenkung die vom Fahrer über den mechanischen Antriebsstrang auf den Achsschenkel ausgeübte Kraft bei weitem nicht aus, um das Lenkrad auszulenken und eine Lenkung zu erreichen. Daher muss die Servolenkung solcher Fahrzeuge besonders zuverlässig sein.
Abbildung 2 Schematische Darstellung des Aufbaus der hydraulischen Servolenkung
Abbildung 2 Schematische Darstellung des Aufbaus der hydraulischen Servolenkung
Abb. 2 zeigt schematisch den Aufbau einer hydraulischen Servolenkung und deren Rohrleitungen. Die Servolenkung besteht aus einem Lenköltank 9, einer Lenkölpumpe 10, einem Lenksteuerventil 5 und einem Lenkkraftzylinder 12. Dreht der Fahrer das Lenkrad 1 gegen den Uhrzeigersinn (Linkslenkung), bewegt der Lenkkipphebel 7 die Lenkstange 6 nach vorne. Die Zugkraft der Spurstange wirkt auf den Achsschenkelhebel 4 und wird auf den Trapezlenker 3 und die Spurstange 11 übertragen, wodurch diese nach rechts bewegt wird. Gleichzeitig betätigt die Lenkstange den Schieber im Lenksteuerventil 5, wodurch die rechte Kammer des Lenkkraftzylinders 12 drucklos mit dem Lenköltank verbunden wird. Das Hochdrucköl der Ölpumpe 10 gelangt in den linken Hohlraum des Lenkkraftzylinders. Dadurch wird die nach rechts gerichtete Hydraulikkraft auf den Kolben des Lenkkraftzylinders über die Schubstange auf die Spurstange 11 ausgeübt, wodurch diese ebenfalls nach rechts bewegt wird. Auf diese Weise kann ein kleines, vom Fahrer auf das Lenkrad ausgeübtes Lenkdrehmoment den Lenkwiderstand überwinden, der durch den Untergrund auf das Lenkrad wirkt.